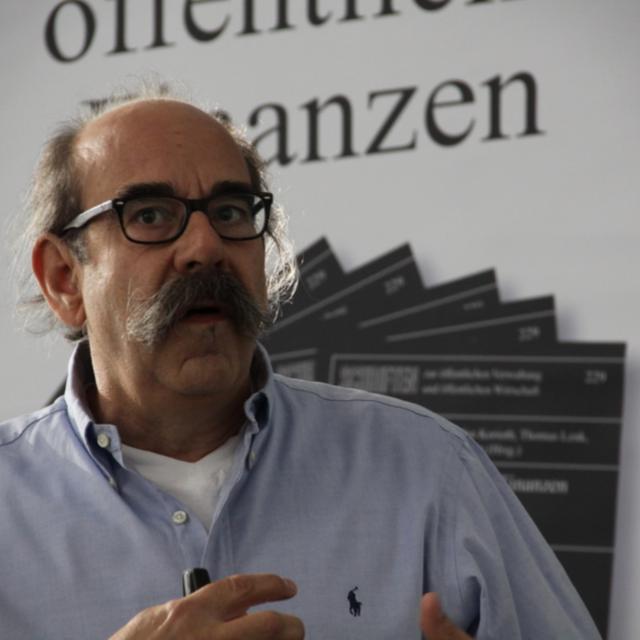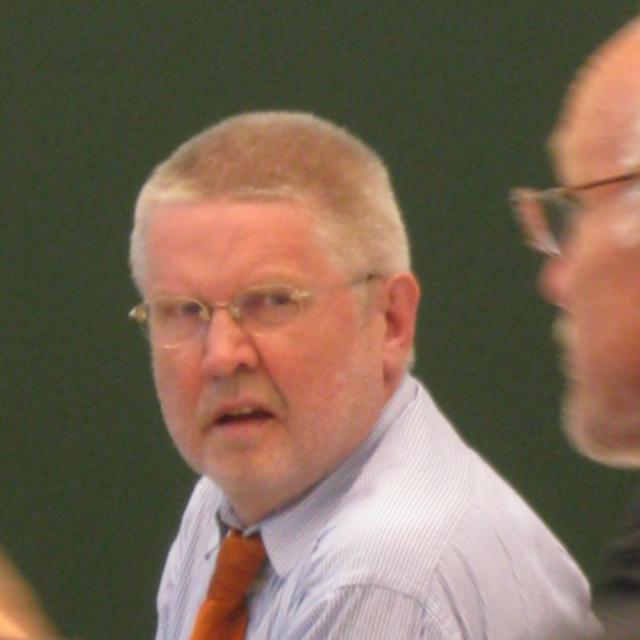Jahrbuch für öffentliche Finanzen (JöFin)
08. Workshop des Jahrbuchs am 18./19.09.2015
Zum 8. Workshop des Jahrbuchs für öffentliche Finanzen hatten die Herausgeber zum 18./19.9.2015 wieder in die Universität Leipzig in den  schönen Felix-Klein-Hörsaal des neuen Paulinums geladen. Staatssekretär Uwe Gaul vom sächsischen Kultus- und Wissenschaftsministerium überbrachte die Grüße der Landesregierung und würdigte das Engagement der (ehrenamtlichen) Herausgeber und Autorinnen und Autoren, insbesondere aber die Verdienste des Lehrstuhls von Prof. Lenk um dieses bundesweit beachtete Publikationsprojekt. Als Zeichen für das weltoffene Leipzig wies er auf die Initiative von 600 Studenten hin, die die in der Uni-Sporthalle untergebrachten Flüchtlinge unterstützten. Die tagespolitischen Bezüge seines Grußwortes zeigten den Teilnehmern an, dass mit dem Jahr 2015 die „ruhigen Jahre“ seit der Finanzkrise vorbei sind.
schönen Felix-Klein-Hörsaal des neuen Paulinums geladen. Staatssekretär Uwe Gaul vom sächsischen Kultus- und Wissenschaftsministerium überbrachte die Grüße der Landesregierung und würdigte das Engagement der (ehrenamtlichen) Herausgeber und Autorinnen und Autoren, insbesondere aber die Verdienste des Lehrstuhls von Prof. Lenk um dieses bundesweit beachtete Publikationsprojekt. Als Zeichen für das weltoffene Leipzig wies er auf die Initiative von 600 Studenten hin, die die in der Uni-Sporthalle untergebrachten Flüchtlinge unterstützten. Die tagespolitischen Bezüge seines Grußwortes zeigten den Teilnehmern an, dass mit dem Jahr 2015 die „ruhigen Jahre“ seit der Finanzkrise vorbei sind.
Im ersten Themenblock wurde zunächst das europäische Umfeld aufgerufen mit analytischen Beiträgen vor allem zur wirtschaftlichen Entwicklung. Truger (Berlin) erneuerte seine Kritik an den geltenden wirtschaftspolitischen Leitvorstellungen am Maßstab der tatsächlichen Entwicklung namentlich in den südeuropäischen Ländern. Meyer-Rix (Berlin) entwickelte seine politische Kritik am Regime der Zentralbanken aus den Vorjahren weiter und wies auf die erheblichen neuen Krisenpotentiale außerhalb des Euro-Raumes hin.
Mit den Beiträgen von Ragnitz (Dresden) und Kahlhöfer (Erfurt) wurden die wirtschaftlichen Perspektiven der neuen Länder 25 Jahre nach der Deutschen Einheit beleuchtet. Während Ragnitz ein eher skeptisches Bild aus gesamtwirtschaftlicher Sicht entwarf, beschrieb Kahlhöfer die beharrlichen „Mühen der Ebene“ mit den Defiziten der betrieblichen Wirklichkeit in Ostdeutschland. Den Themenblock schloss Hengstenberg (Schwerin) mit seinem Bericht zur Arbeit einer ostdeutschen Prüfbehörde von EU-Fördermitteln ab, die zwar nicht die richterliche Unabhängig deutscher Rechnungshöfe aufweise, dafür aber unmittelbare finanzielle Wirkung erzielen könne („.. zwar auch kein Schwert, aber immerhin eine Lanze!“).
Nach der Pause eröffnete Schulte (Hamburg) das Themenfeld zum Finanzausgleich mit einer kritischen Prüfung der Frage, ob die Abschaffung des Umsatzsteuervorwegausgleichs Nordrhein-Westfalen wieder dauerhaft in eine Zahlerrolle bringen könnte? Es spreche sehr viel dafür, dass das Ziel verfehlt, aber dafür der Finanzausgleich in seinen Grundlagen gefährdet würde. Woisin (Hamburg) forderte unter Verweis auf die aktuellen Prognosen von BMF und ZDL sowie den Finanzplanungen der Länder für die Länderebene ein Finanzvolumen von deutlich mehr als 6 Mrd. €, um ab 2020 die Schuldenbremse einhalten zu können und die zunehmenden Disparitäten der Länder zu dämpfen. Weiß (Wiesbaden) und Münzenmaier (Erfurt) stellten ihre gemeinsame, grundlegende Untersuchung zur Lohnsteuerzerlegung und zur Pendlerlohnsteuer vor. Sie zeigten auf, dass die finanziellen Wirkungen bisher unterschätzt wurden. Lenk/Glinka (Leipzig) knüpften an ihren Befund aus dem Vorjahr an, wonach örtliches Steueraufkommen und Bruttowertschöpfung bei den Ländern auffällige Unterschiede zeigten. Sie wiesen die enormen finanziellen Wirkungen nach, die eine regionale Steuerverteilung am Maßstab der Bruttowertschöpfung hätte. Anton (DST) entwickelte einen Kriterienkatalog für transparente Finanzpolitik nach Maßgabe praktischer Vernunft, der sich von der politischen Realität in weiter Entfernung befindet. So erschien der mit Spannung erwartete Bericht von Ratzmann (Berlin/Stuttgart) zum aktuellen Verhandlungsstand der Ministerpräsidenten wie eine ungewollte Bestätigung Antons. Ratzmann erläuterte die Modelle der B-Seite und der A-Seite, die beide auf ihre Weise der Forderung NRWs nach Abschaffung des Umsatzsteuervorwegausgleichs – unter Verletzung des Verfassungsrahmens - nachzukommen suchten. Eine Einigung am Rande des Flüchtlingsgipfels am 24.9.2015 schien ihm möglich. Die Diskussion blieb kontrovers, überwiegend wurde der status quo jedoch als sachgerechter erkannt. Mit dem Bericht Ratzmanns hatte der erste Verhandlungstag zugleich seinen Höhepunkt und Abschluss gefunden.
Der zweite Verhandlungstag wurde eröffnet von Ulrich Keilmann (Darmstadt) mit dem Vorschlag der Nachhaltigkeitssatzung als doppische Kommunalschuldenbremse, die in Hessen erste Anwendung findet und für die kommunale Finanzpolitik ein neues Instrument darstellt. Auf erhebliches Interesse stieß auch der Vortrag von Rösel (Dresden) zur Struktur kommunaler Verschuldung. Er stellte eine Auswertung der neuen Datensätze von Destatis nach dem Schalenkonzept vor. Rösel/Frei konnten zeigen, dass sich die Verschuldung pro Kopf erheblich gleichmäßiger verteilt als bislang gemeinhin angenommen. Der Befund erregte erhebliches Aufsehen unter den Teilnehmern und führte zu einer lebhaften Diskussions- und Fragerunde. Rösel blieb zurückhaltend in weitergehenden Interpretationen und konzentrierte sich auf die Darstellung des Befundes.
Die Abteilung zur Finanzverfassung und Praxis der Kooperation eröffnete im Anschluss Marc Brüser (Mainz) mit einem Bericht zur dritten Fortsetzung des „Paktes für Forschung und Innovation“ bis 2021, der eine komplexe Lösung für die Organisation des weiteren Mittelaufwuchses allein zu Lasten des Bundes erforderte. Ihm folgte Lars Hummel (Hamburg) mit einer rechtswissenschaftlichen Erörterung der Zulässigkeitskriterien für Sonderabgaben. Die Diskussion schärfte die Kritik an neuerer Rechtsprechung zu und erlaubte auch politische Schlussfolgerungen für künftige Sonderabgaben. Den Abschluss der Fachbeiträge bildete der hochaktuelle Beitrag von Staatsrat Fries (Bremen; Soziales) zu den Kosten der Flüchtlingswelle.
Den Schlusspunkt bildeten die Abkündigungen von Woisin zu Organisation und Terminleiste des nächsten Jahrbuchs.
In der lebhaften Generaldebatte ging es durchaus kontrovers zu, wobei sich allerdings optimistische Töne behaupten konnten. Fries sah Erfolge der Länder in der Selbstbehauptung gegenüber dem Bund, Anton forderte, sich angesichts der Flüchtlingsdramatik nicht in einem „Krisenrausch“ zu verlieren. Ebert (Berlin), Schulte, Steinbach (Mainz), Plenz (Hannover) formulierten Schlussfolgerungen für das nächste Jahrbuch.
Der zweite Verhandlungstag verlief wesentlich diskussionsintensiver als der erste, was möglicherweise auch dem gesellschaftlichen Höhepunkt der Tagung am Vorabend geschuldet war. Bereits einer Tradition folgend hatte die Bundesbank die Teilnehmer zu einem festlichen Abendessen in ihrer Filiale Leipzig eingeladen.
Programm des 8. Workshop
 schönen Felix-Klein-Hörsaal des neuen Paulinums geladen. Staatssekretär Uwe Gaul vom sächsischen Kultus- und Wissenschaftsministerium überbrachte die Grüße der Landesregierung und würdigte das Engagement der (ehrenamtlichen) Herausgeber und Autorinnen und Autoren, insbesondere aber die Verdienste des Lehrstuhls von Prof. Lenk um dieses bundesweit beachtete Publikationsprojekt. Als Zeichen für das weltoffene Leipzig wies er auf die Initiative von 600 Studenten hin, die die in der Uni-Sporthalle untergebrachten Flüchtlinge unterstützten. Die tagespolitischen Bezüge seines Grußwortes zeigten den Teilnehmern an, dass mit dem Jahr 2015 die „ruhigen Jahre“ seit der Finanzkrise vorbei sind.
schönen Felix-Klein-Hörsaal des neuen Paulinums geladen. Staatssekretär Uwe Gaul vom sächsischen Kultus- und Wissenschaftsministerium überbrachte die Grüße der Landesregierung und würdigte das Engagement der (ehrenamtlichen) Herausgeber und Autorinnen und Autoren, insbesondere aber die Verdienste des Lehrstuhls von Prof. Lenk um dieses bundesweit beachtete Publikationsprojekt. Als Zeichen für das weltoffene Leipzig wies er auf die Initiative von 600 Studenten hin, die die in der Uni-Sporthalle untergebrachten Flüchtlinge unterstützten. Die tagespolitischen Bezüge seines Grußwortes zeigten den Teilnehmern an, dass mit dem Jahr 2015 die „ruhigen Jahre“ seit der Finanzkrise vorbei sind. Im ersten Themenblock wurde zunächst das europäische Umfeld aufgerufen mit analytischen Beiträgen vor allem zur wirtschaftlichen Entwicklung. Truger (Berlin) erneuerte seine Kritik an den geltenden wirtschaftspolitischen Leitvorstellungen am Maßstab der tatsächlichen Entwicklung namentlich in den südeuropäischen Ländern. Meyer-Rix (Berlin) entwickelte seine politische Kritik am Regime der Zentralbanken aus den Vorjahren weiter und wies auf die erheblichen neuen Krisenpotentiale außerhalb des Euro-Raumes hin.
Mit den Beiträgen von Ragnitz (Dresden) und Kahlhöfer (Erfurt) wurden die wirtschaftlichen Perspektiven der neuen Länder 25 Jahre nach der Deutschen Einheit beleuchtet. Während Ragnitz ein eher skeptisches Bild aus gesamtwirtschaftlicher Sicht entwarf, beschrieb Kahlhöfer die beharrlichen „Mühen der Ebene“ mit den Defiziten der betrieblichen Wirklichkeit in Ostdeutschland. Den Themenblock schloss Hengstenberg (Schwerin) mit seinem Bericht zur Arbeit einer ostdeutschen Prüfbehörde von EU-Fördermitteln ab, die zwar nicht die richterliche Unabhängig deutscher Rechnungshöfe aufweise, dafür aber unmittelbare finanzielle Wirkung erzielen könne („.. zwar auch kein Schwert, aber immerhin eine Lanze!“).
Nach der Pause eröffnete Schulte (Hamburg) das Themenfeld zum Finanzausgleich mit einer kritischen Prüfung der Frage, ob die Abschaffung des Umsatzsteuervorwegausgleichs Nordrhein-Westfalen wieder dauerhaft in eine Zahlerrolle bringen könnte? Es spreche sehr viel dafür, dass das Ziel verfehlt, aber dafür der Finanzausgleich in seinen Grundlagen gefährdet würde. Woisin (Hamburg) forderte unter Verweis auf die aktuellen Prognosen von BMF und ZDL sowie den Finanzplanungen der Länder für die Länderebene ein Finanzvolumen von deutlich mehr als 6 Mrd. €, um ab 2020 die Schuldenbremse einhalten zu können und die zunehmenden Disparitäten der Länder zu dämpfen. Weiß (Wiesbaden) und Münzenmaier (Erfurt) stellten ihre gemeinsame, grundlegende Untersuchung zur Lohnsteuerzerlegung und zur Pendlerlohnsteuer vor. Sie zeigten auf, dass die finanziellen Wirkungen bisher unterschätzt wurden. Lenk/Glinka (Leipzig) knüpften an ihren Befund aus dem Vorjahr an, wonach örtliches Steueraufkommen und Bruttowertschöpfung bei den Ländern auffällige Unterschiede zeigten. Sie wiesen die enormen finanziellen Wirkungen nach, die eine regionale Steuerverteilung am Maßstab der Bruttowertschöpfung hätte. Anton (DST) entwickelte einen Kriterienkatalog für transparente Finanzpolitik nach Maßgabe praktischer Vernunft, der sich von der politischen Realität in weiter Entfernung befindet. So erschien der mit Spannung erwartete Bericht von Ratzmann (Berlin/Stuttgart) zum aktuellen Verhandlungsstand der Ministerpräsidenten wie eine ungewollte Bestätigung Antons. Ratzmann erläuterte die Modelle der B-Seite und der A-Seite, die beide auf ihre Weise der Forderung NRWs nach Abschaffung des Umsatzsteuervorwegausgleichs – unter Verletzung des Verfassungsrahmens - nachzukommen suchten. Eine Einigung am Rande des Flüchtlingsgipfels am 24.9.2015 schien ihm möglich. Die Diskussion blieb kontrovers, überwiegend wurde der status quo jedoch als sachgerechter erkannt. Mit dem Bericht Ratzmanns hatte der erste Verhandlungstag zugleich seinen Höhepunkt und Abschluss gefunden.
Der zweite Verhandlungstag wurde eröffnet von Ulrich Keilmann (Darmstadt) mit dem Vorschlag der Nachhaltigkeitssatzung als doppische Kommunalschuldenbremse, die in Hessen erste Anwendung findet und für die kommunale Finanzpolitik ein neues Instrument darstellt. Auf erhebliches Interesse stieß auch der Vortrag von Rösel (Dresden) zur Struktur kommunaler Verschuldung. Er stellte eine Auswertung der neuen Datensätze von Destatis nach dem Schalenkonzept vor. Rösel/Frei konnten zeigen, dass sich die Verschuldung pro Kopf erheblich gleichmäßiger verteilt als bislang gemeinhin angenommen. Der Befund erregte erhebliches Aufsehen unter den Teilnehmern und führte zu einer lebhaften Diskussions- und Fragerunde. Rösel blieb zurückhaltend in weitergehenden Interpretationen und konzentrierte sich auf die Darstellung des Befundes.
Die Abteilung zur Finanzverfassung und Praxis der Kooperation eröffnete im Anschluss Marc Brüser (Mainz) mit einem Bericht zur dritten Fortsetzung des „Paktes für Forschung und Innovation“ bis 2021, der eine komplexe Lösung für die Organisation des weiteren Mittelaufwuchses allein zu Lasten des Bundes erforderte. Ihm folgte Lars Hummel (Hamburg) mit einer rechtswissenschaftlichen Erörterung der Zulässigkeitskriterien für Sonderabgaben. Die Diskussion schärfte die Kritik an neuerer Rechtsprechung zu und erlaubte auch politische Schlussfolgerungen für künftige Sonderabgaben. Den Abschluss der Fachbeiträge bildete der hochaktuelle Beitrag von Staatsrat Fries (Bremen; Soziales) zu den Kosten der Flüchtlingswelle.
Den Schlusspunkt bildeten die Abkündigungen von Woisin zu Organisation und Terminleiste des nächsten Jahrbuchs.
In der lebhaften Generaldebatte ging es durchaus kontrovers zu, wobei sich allerdings optimistische Töne behaupten konnten. Fries sah Erfolge der Länder in der Selbstbehauptung gegenüber dem Bund, Anton forderte, sich angesichts der Flüchtlingsdramatik nicht in einem „Krisenrausch“ zu verlieren. Ebert (Berlin), Schulte, Steinbach (Mainz), Plenz (Hannover) formulierten Schlussfolgerungen für das nächste Jahrbuch.
Der zweite Verhandlungstag verlief wesentlich diskussionsintensiver als der erste, was möglicherweise auch dem gesellschaftlichen Höhepunkt der Tagung am Vorabend geschuldet war. Bereits einer Tradition folgend hatte die Bundesbank die Teilnehmer zu einem festlichen Abendessen in ihrer Filiale Leipzig eingeladen.
Programm des 8. Workshop
Präsentationen
Prof. Dr. Joachim Ragnitz
Prof. Dr. Achim Truger
Xenia Frei / Felix Rösel
Reinhold Weiß / Dr. Werner Münzenmaier
Ulrich Kahlhöfer
Hubert Schulte
Ulf Meyer-Rix
Dirk Hengstenberg
Dr. Matthias Woisin
Stefan Anton
Dr. Marc Brüser
Dr. Ulrich Keilmann
Prof. Dr. Thomas Lenk / Philipp Glinka
Prof. Dr. Thomas Lenk
Prof. Dr. Joachim Ragnitz
Prof. Dr. Achim Truger
Xenia Frei / Felix Rösel
Reinhold Weiß / Dr. Werner Münzenmaier
Ulrich Kahlhöfer
Hubert Schulte
Ulf Meyer-Rix
Dirk Hengstenberg
Dr. Matthias Woisin
Stefan Anton
Dr. Marc Brüser
Dr. Ulrich Keilmann
Prof. Dr. Thomas Lenk / Philipp Glinka
Prof. Dr. Thomas Lenk
Verlag
Das Jahrbuch für öffentliche Finanzen erscheint als Zeitschrift zweimal jährlich im Berliner Wissenschaftsverlag. Es wird betreut vom Lehrstuhl Finanzwissenschaft der Uni Leipzig.
Kontakt: redaktion[at]joefin.de
Das Jahrbuch für öffentliche Finanzen erscheint als Zeitschrift zweimal jährlich im Berliner Wissenschaftsverlag. Es wird betreut vom Lehrstuhl Finanzwissenschaft der Uni Leipzig.
Kontakt: redaktion[at]joefin.de
Projekt
Das Jahrbuch ist ein interdisziplinäres Projekt aus Rechts-, Finanz- und Politikwissenschaft sowie der Verwaltungspraxis. Das Projekt ist unabhängig, ehrenamtlich und wird gefördert von der Bundesbank.
Das Jahrbuch ist ein interdisziplinäres Projekt aus Rechts-, Finanz- und Politikwissenschaft sowie der Verwaltungspraxis. Das Projekt ist unabhängig, ehrenamtlich und wird gefördert von der Bundesbank.
Interesse
Im Vordergrund stehen die Landes- und Gemeindehaushalte sowie die föderalen Finanzbeziehungen.
Im Vordergrund stehen die Landes- und Gemeindehaushalte sowie die föderalen Finanzbeziehungen.