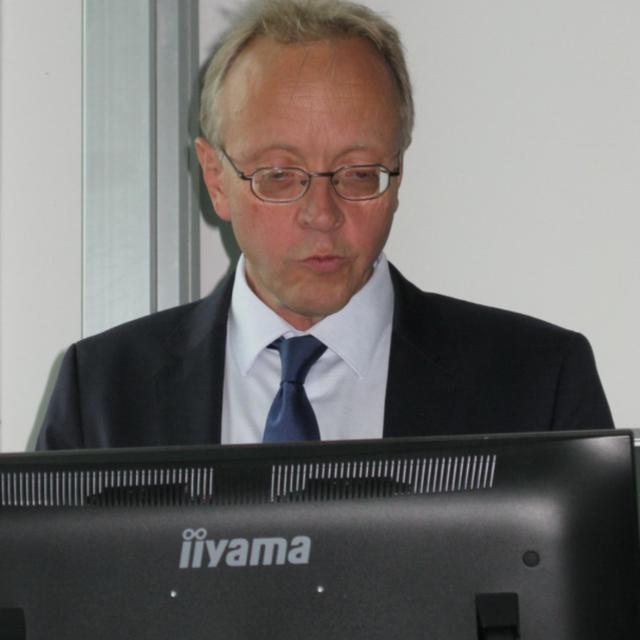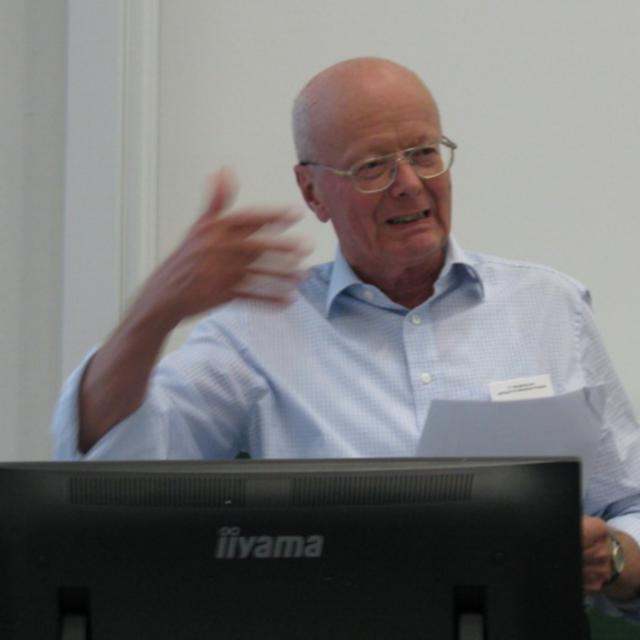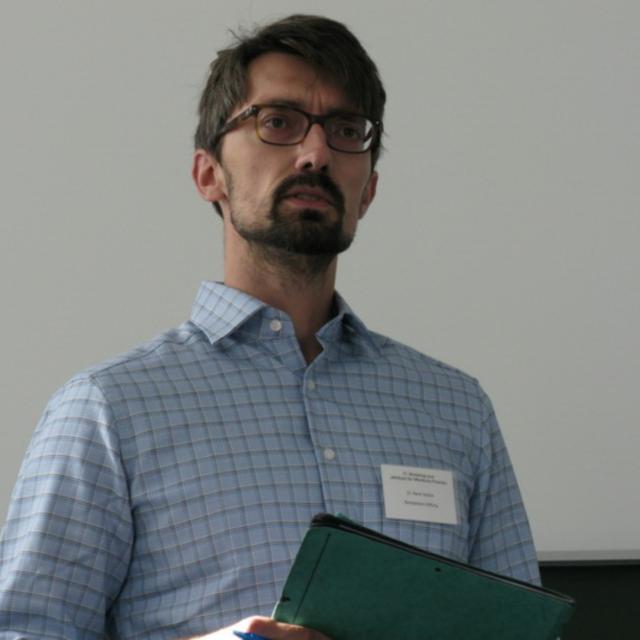Jahrbuch für öffentliche Finanzen (JöFin)
11. Workshop des Jahrbuchs am 21./22.09.2018
11. Workshop in Leipzig - Tagungsbericht
Mit mehr als siebzig Teilnehmerinnen und Teilnehmern konnte Prof. Dr. Thomas Lenk, Prorektor der Uni-Leipzig und Jahrbuch-Herausgeber, in seinem Grußwort zum diesjährigen Workshop des Jahrbuchs am 21.9.2018 im Felix-Klein-Hörsaal des neuen Augustinums eine Rekordbeteiligung feststellen. Das Interesse galt einem dichtgedrängten und dabei aktuellen Programm getragen von 23 vortragenden Kolleginnen und Kollegen unter dem Titel „Zentral und vertikal – Umbau des Bundesstaates“.
 Finanzminister a.D. Prof. Dr. Carsten Kühl, Präsident des Deutschen Instituts für Urbanistik, verband seine kritischen Anmerkungen zur Finanzverteilung im Bundestaat mit der Vorstellung des druckfrischen Halbbandes des Jahrbuchs 2-2018. Mit einer frühzeitigen Intervention von Prof. Dr. Hans- Günter Henneke zur aktuellen Verfassungsdiskussion eines neuen Art. 104 d GG war der muntere Debattenstil dieses Workshops gefunden. Ihm folgte der Beitrag von Michael Thöne (FiFo Köln) und Finanzminister a.D. Jens Bullerjahn mit einer Post-Reform-Analyse zum Status Quo des Finanzföderalismus, die auch Bewährtes und Funktionsgerechtes in den Blick nahm. Dr. Tim Griebel, Erlangen, präsentierte eine linguistische Arbeit, die die Verwendung des Begriffs Austerität in der deutschen Presse seit der Finanzkrise zum Gegenstand hatte. Mit einem Kriterienkatalog, den der Hamburger Rechnungshof seinem Schuldenmonitoring zugrunde legt, konnte Direktor Philipp Häfner das Auditorium beeindrucken. Zumal er Fragestellungen berührte, die derzeit beim BMF und im Kontext des Stabilitätsrates fachlich aktuell sind. Erwartungsgemäß kontrovers wurde dagegen der Beitrag von Dr. Matthias Woisin aufgenommen, der den Abbau des Schuldenstandes unter Nullzinsbedingungen als für die öffentlichen Haushalte unwirtschaftlich angriff.
Finanzminister a.D. Prof. Dr. Carsten Kühl, Präsident des Deutschen Instituts für Urbanistik, verband seine kritischen Anmerkungen zur Finanzverteilung im Bundestaat mit der Vorstellung des druckfrischen Halbbandes des Jahrbuchs 2-2018. Mit einer frühzeitigen Intervention von Prof. Dr. Hans- Günter Henneke zur aktuellen Verfassungsdiskussion eines neuen Art. 104 d GG war der muntere Debattenstil dieses Workshops gefunden. Ihm folgte der Beitrag von Michael Thöne (FiFo Köln) und Finanzminister a.D. Jens Bullerjahn mit einer Post-Reform-Analyse zum Status Quo des Finanzföderalismus, die auch Bewährtes und Funktionsgerechtes in den Blick nahm. Dr. Tim Griebel, Erlangen, präsentierte eine linguistische Arbeit, die die Verwendung des Begriffs Austerität in der deutschen Presse seit der Finanzkrise zum Gegenstand hatte. Mit einem Kriterienkatalog, den der Hamburger Rechnungshof seinem Schuldenmonitoring zugrunde legt, konnte Direktor Philipp Häfner das Auditorium beeindrucken. Zumal er Fragestellungen berührte, die derzeit beim BMF und im Kontext des Stabilitätsrates fachlich aktuell sind. Erwartungsgemäß kontrovers wurde dagegen der Beitrag von Dr. Matthias Woisin aufgenommen, der den Abbau des Schuldenstandes unter Nullzinsbedingungen als für die öffentlichen Haushalte unwirtschaftlich angriff.
Nach einer kurzen Pause, die sich das debattenfreudige Auditorium verdient hatte, eröffnete Ulf Meyer-Rix die Abteilung „Finanzpolitik im europäischen Umfeld“. Er rückte in den Mittelpunkt das jüngst erschienene Werk „crashed“ des britischen Wirtschaftshistorikers Adam Tooze zur globalen Finanzkrise des Jahres 2008. Im Kern gehe es darum, die Finanzkrise als einen tiefen Epochenbruch zu verstehen, der unsere heutige Gegenwart von der Welt vor 2008 trennt – als historische Zäsur von ähnlicher Tiefe wie der Erste Weltkrieg. Mit dem Beitrag von Dr. Thieß Petersen wurden Globalisierungsfolgen hinsichtlich der Einkommensverteilung thematisiert und finanzpolitische Schlussfolgerungen angeboten. Ihm folgte Dr. Martin Snelting (BMF), der einen aufregenden Versuch zur Systematisierung verschiedener Rücklagetechniken in Bezug auf ihre Maastricht-Relevanz darstellte. Im Kern konnte er darlegen, dass kaum eine Form geeignet ist, ein Haushaltsdefizit durch Inanspruchnahme eigenen Finanzvermögens maastrichtwirksam auszugleichen. Die Relevanz der Fragestellung konnte anschließend Prof. Dr. Achim Truger illustrieren mit einer Simulation unter der Annahme, dass die beiden wachstumsstarken Jahre nach der Finanzkrise einen lediglich normalen Verlauf genommen hätten. Daraus hätten sich bei sonst gleichem Verlauf für die Gegenwart statt expansiver Haushaltsentwicklungen Konsolidierungszwänge in erheblichem Umfang ergeben.
Mit der Fragestellung „Sozialausgaben statt Investitionen“ war die dritte Abteilung unter der Moderation von Dr. Henrik Scheller befaßt. Prof. em. Dr. Dr. h.c. Horst Zimmermann zeigte, wie er sich auf die Spur des Verdrängungseffektes macht, die die Sozialausgaben auf andere Ausgabearten ausüben. Seine Gegenüberstellungen nahmen den Zeitraum von 1970 bis 2010 in den Blick und führten bereits in der ersten Annäherung zu erstaunlichen Befunden. Viele fachliche Hinweise und engagierte Kommentare waren die Reaktion des Auditoriums. Mit einer historischen Reminiszenz auf die Finanzreform 1969 verband Prof. em. Dr. Wolfgang Renzsch sein Plädoyer für eine Abkehr vom örtlichen Aufkommen hin zu einer „flat-rate“ für die Länder. Dagegen bezog sich Prof. Dr. Ronny Freier auf die aktuelle Debatte zur Grundsteuer und zur Grunderwerbsteuer. Er plädierte für den Verzicht auf die Grunderwerbsteuer und für eine kompensatorisch ausgestaltete Grundsteuer. Damit erntete er allerdings deutliche Kritik, nicht nur wegen der unterschiedlichen „Eigentümerschaft“ beider Steuern. Mit seiner Untersuchung der Spielbankabgabe leuchtete Prof. Dr. Michael Broer in einen fast vergessenen Winkel der Ländereinnahmen, der im Finanzausgleich Berücksichtigung findet. Zur Wirtschaftlichkeit von Länderinvestitionen stellte Dr. Thorsten Winkelmann (Erlangen) eine Auswertung von Rechnungshofberichten vor, in denen insgesamt 409 Bemerkungen zu öffentlichen Bauvorhaben enthalten waren. Aus dem Auditorium gab es Hinweise auf aktuelle Auswertungen, die die Rechnungshöfe selbst erstellt haben sowie auf die Erkenntnisse der Bauministerkonferenz und auf die einschlägigen Regelwerke, deren Kenntnis vor allzu schnellen Schlussfolgerungen schützen sollten.
Den zweiten Konferenztag, moderiert von Prof. Dr. Martin Junkernheinrich, eröffnete die Bundestagsabgeordnete Cansel Kiziltepe (SPD) mit einem Referat zum steuerpolitischen Attentismus der Großen Koalition. Allein die Reform der Grundsteuer sei im Koalitionsvertrag verankert. Zum Kommunalinvestitionsfördergesetz stellte Dr. René Geißler (Bertelsmann) in einer systematischen Übersicht vor, wie die Länder das Kriterium „Finanzschwäche“ für die Kommunen dargestellt hätten. Aus dem Kreis der Verwaltungspraktiker wurde seine Vermutung bestätigt, dass das Kriterium jeweils dem praktischen Zweck angepasst wurde, am Ende mit den Bundesmitteln die tatsächlich erforderlichen Schulgebäude errichten oder sanieren zu können. Mit der Analyse von Dr. Felix Rösel (Ifo Dresden) zur Frage nach Wirkung und Kosten der Einführung des kaufmännischen Rechnungswesens war eine Kontroverse aufgerufen, die die Kämmerer seit Jahren beschäftigt. Rösel zeigte am Beispiel Bayerns, dass die Einführung der Doppik in der Haushaltswirkung nur in der Steigerung der Sachkosten eine empirische Spur hinterlässt, weil sie mit erheblichen Beratungs- und Lizenzkosten verbunden ist. Sachlichen Widerspruch fomulierte Prof. Dr. Isabelle Jänchen (Meißen). Aus der Arbeit des hessischen Rechnungshofes – der ausschließlich im doppisch buchenden Umfeld arbeitet – berichtete Dr. Ulrich Keilmann zur Entwicklung eines neuen Siedlungsindex, der das Problem der Kosten der Zersiedelung in den Blick nimmt. Vor allem machte er auf neue methodische Möglichkeiten durch Geodatenanalysen aufmerksam, die seit Neuestem komfortabel verfügbar seien. Zum Abschluss referierte Dr. habil. Christian Pfeil zu den grundlegenden Dilemmata, in denen der Stabilitätsrat seine Überwachung der Schuldenbremsen ab 2020 etablieren muss. Zwar lobte er den Stabilitätsrat hinsichtlich Wirkung und Bedeutung, versagte sich aber jeden Hinweis auf mögliche Auswege aus den Aporien, die der Gesetzgeber mit der leichter Hand aufgetürmt hat. Die nachfolgende Diskussion zeigte mehr Betroffenheit als Freude am Widerspruch.
Das übliche Projektgespräch am Schluss der Tagung nutzte Mitherausgeber Dr. Matthias Woisin für einen Einblick in die Überlegungen zur Weitentwicklung des Jahrbuchs und für Hinweise auf die aktuelle Diskussion im Kreis der Länderberichtsautoren. Prof. Dr. Thomas Lenk verabschiedete die Teilnehmer und schloss die Tagung mit einem Dank an das Orga-Team des Lehrstuhls und die Hilfe der Leipziger Sparkasse.
Auch der 11. Workshop wurde unterstützt von der Bundesbank in Leipzig, die den Teilnehmern zudem einen festlichen Abend bereitete, den Präsident Dr. Hubert Temmeyer mit einigen aktuellen fachlichen Hinweisen eröffnete. Der Hoffnung einiger Teilnehmer auf baldige Erhöhung des Leitzinses konnte er keine Nahrung geben.
Mit mehr als siebzig Teilnehmerinnen und Teilnehmern konnte Prof. Dr. Thomas Lenk, Prorektor der Uni-Leipzig und Jahrbuch-Herausgeber, in seinem Grußwort zum diesjährigen Workshop des Jahrbuchs am 21.9.2018 im Felix-Klein-Hörsaal des neuen Augustinums eine Rekordbeteiligung feststellen. Das Interesse galt einem dichtgedrängten und dabei aktuellen Programm getragen von 23 vortragenden Kolleginnen und Kollegen unter dem Titel „Zentral und vertikal – Umbau des Bundesstaates“.
 Finanzminister a.D. Prof. Dr. Carsten Kühl, Präsident des Deutschen Instituts für Urbanistik, verband seine kritischen Anmerkungen zur Finanzverteilung im Bundestaat mit der Vorstellung des druckfrischen Halbbandes des Jahrbuchs 2-2018. Mit einer frühzeitigen Intervention von Prof. Dr. Hans- Günter Henneke zur aktuellen Verfassungsdiskussion eines neuen Art. 104 d GG war der muntere Debattenstil dieses Workshops gefunden. Ihm folgte der Beitrag von Michael Thöne (FiFo Köln) und Finanzminister a.D. Jens Bullerjahn mit einer Post-Reform-Analyse zum Status Quo des Finanzföderalismus, die auch Bewährtes und Funktionsgerechtes in den Blick nahm. Dr. Tim Griebel, Erlangen, präsentierte eine linguistische Arbeit, die die Verwendung des Begriffs Austerität in der deutschen Presse seit der Finanzkrise zum Gegenstand hatte. Mit einem Kriterienkatalog, den der Hamburger Rechnungshof seinem Schuldenmonitoring zugrunde legt, konnte Direktor Philipp Häfner das Auditorium beeindrucken. Zumal er Fragestellungen berührte, die derzeit beim BMF und im Kontext des Stabilitätsrates fachlich aktuell sind. Erwartungsgemäß kontrovers wurde dagegen der Beitrag von Dr. Matthias Woisin aufgenommen, der den Abbau des Schuldenstandes unter Nullzinsbedingungen als für die öffentlichen Haushalte unwirtschaftlich angriff.
Finanzminister a.D. Prof. Dr. Carsten Kühl, Präsident des Deutschen Instituts für Urbanistik, verband seine kritischen Anmerkungen zur Finanzverteilung im Bundestaat mit der Vorstellung des druckfrischen Halbbandes des Jahrbuchs 2-2018. Mit einer frühzeitigen Intervention von Prof. Dr. Hans- Günter Henneke zur aktuellen Verfassungsdiskussion eines neuen Art. 104 d GG war der muntere Debattenstil dieses Workshops gefunden. Ihm folgte der Beitrag von Michael Thöne (FiFo Köln) und Finanzminister a.D. Jens Bullerjahn mit einer Post-Reform-Analyse zum Status Quo des Finanzföderalismus, die auch Bewährtes und Funktionsgerechtes in den Blick nahm. Dr. Tim Griebel, Erlangen, präsentierte eine linguistische Arbeit, die die Verwendung des Begriffs Austerität in der deutschen Presse seit der Finanzkrise zum Gegenstand hatte. Mit einem Kriterienkatalog, den der Hamburger Rechnungshof seinem Schuldenmonitoring zugrunde legt, konnte Direktor Philipp Häfner das Auditorium beeindrucken. Zumal er Fragestellungen berührte, die derzeit beim BMF und im Kontext des Stabilitätsrates fachlich aktuell sind. Erwartungsgemäß kontrovers wurde dagegen der Beitrag von Dr. Matthias Woisin aufgenommen, der den Abbau des Schuldenstandes unter Nullzinsbedingungen als für die öffentlichen Haushalte unwirtschaftlich angriff. Nach einer kurzen Pause, die sich das debattenfreudige Auditorium verdient hatte, eröffnete Ulf Meyer-Rix die Abteilung „Finanzpolitik im europäischen Umfeld“. Er rückte in den Mittelpunkt das jüngst erschienene Werk „crashed“ des britischen Wirtschaftshistorikers Adam Tooze zur globalen Finanzkrise des Jahres 2008. Im Kern gehe es darum, die Finanzkrise als einen tiefen Epochenbruch zu verstehen, der unsere heutige Gegenwart von der Welt vor 2008 trennt – als historische Zäsur von ähnlicher Tiefe wie der Erste Weltkrieg. Mit dem Beitrag von Dr. Thieß Petersen wurden Globalisierungsfolgen hinsichtlich der Einkommensverteilung thematisiert und finanzpolitische Schlussfolgerungen angeboten. Ihm folgte Dr. Martin Snelting (BMF), der einen aufregenden Versuch zur Systematisierung verschiedener Rücklagetechniken in Bezug auf ihre Maastricht-Relevanz darstellte. Im Kern konnte er darlegen, dass kaum eine Form geeignet ist, ein Haushaltsdefizit durch Inanspruchnahme eigenen Finanzvermögens maastrichtwirksam auszugleichen. Die Relevanz der Fragestellung konnte anschließend Prof. Dr. Achim Truger illustrieren mit einer Simulation unter der Annahme, dass die beiden wachstumsstarken Jahre nach der Finanzkrise einen lediglich normalen Verlauf genommen hätten. Daraus hätten sich bei sonst gleichem Verlauf für die Gegenwart statt expansiver Haushaltsentwicklungen Konsolidierungszwänge in erheblichem Umfang ergeben.
Mit der Fragestellung „Sozialausgaben statt Investitionen“ war die dritte Abteilung unter der Moderation von Dr. Henrik Scheller befaßt. Prof. em. Dr. Dr. h.c. Horst Zimmermann zeigte, wie er sich auf die Spur des Verdrängungseffektes macht, die die Sozialausgaben auf andere Ausgabearten ausüben. Seine Gegenüberstellungen nahmen den Zeitraum von 1970 bis 2010 in den Blick und führten bereits in der ersten Annäherung zu erstaunlichen Befunden. Viele fachliche Hinweise und engagierte Kommentare waren die Reaktion des Auditoriums. Mit einer historischen Reminiszenz auf die Finanzreform 1969 verband Prof. em. Dr. Wolfgang Renzsch sein Plädoyer für eine Abkehr vom örtlichen Aufkommen hin zu einer „flat-rate“ für die Länder. Dagegen bezog sich Prof. Dr. Ronny Freier auf die aktuelle Debatte zur Grundsteuer und zur Grunderwerbsteuer. Er plädierte für den Verzicht auf die Grunderwerbsteuer und für eine kompensatorisch ausgestaltete Grundsteuer. Damit erntete er allerdings deutliche Kritik, nicht nur wegen der unterschiedlichen „Eigentümerschaft“ beider Steuern. Mit seiner Untersuchung der Spielbankabgabe leuchtete Prof. Dr. Michael Broer in einen fast vergessenen Winkel der Ländereinnahmen, der im Finanzausgleich Berücksichtigung findet. Zur Wirtschaftlichkeit von Länderinvestitionen stellte Dr. Thorsten Winkelmann (Erlangen) eine Auswertung von Rechnungshofberichten vor, in denen insgesamt 409 Bemerkungen zu öffentlichen Bauvorhaben enthalten waren. Aus dem Auditorium gab es Hinweise auf aktuelle Auswertungen, die die Rechnungshöfe selbst erstellt haben sowie auf die Erkenntnisse der Bauministerkonferenz und auf die einschlägigen Regelwerke, deren Kenntnis vor allzu schnellen Schlussfolgerungen schützen sollten.
Den zweiten Konferenztag, moderiert von Prof. Dr. Martin Junkernheinrich, eröffnete die Bundestagsabgeordnete Cansel Kiziltepe (SPD) mit einem Referat zum steuerpolitischen Attentismus der Großen Koalition. Allein die Reform der Grundsteuer sei im Koalitionsvertrag verankert. Zum Kommunalinvestitionsfördergesetz stellte Dr. René Geißler (Bertelsmann) in einer systematischen Übersicht vor, wie die Länder das Kriterium „Finanzschwäche“ für die Kommunen dargestellt hätten. Aus dem Kreis der Verwaltungspraktiker wurde seine Vermutung bestätigt, dass das Kriterium jeweils dem praktischen Zweck angepasst wurde, am Ende mit den Bundesmitteln die tatsächlich erforderlichen Schulgebäude errichten oder sanieren zu können. Mit der Analyse von Dr. Felix Rösel (Ifo Dresden) zur Frage nach Wirkung und Kosten der Einführung des kaufmännischen Rechnungswesens war eine Kontroverse aufgerufen, die die Kämmerer seit Jahren beschäftigt. Rösel zeigte am Beispiel Bayerns, dass die Einführung der Doppik in der Haushaltswirkung nur in der Steigerung der Sachkosten eine empirische Spur hinterlässt, weil sie mit erheblichen Beratungs- und Lizenzkosten verbunden ist. Sachlichen Widerspruch fomulierte Prof. Dr. Isabelle Jänchen (Meißen). Aus der Arbeit des hessischen Rechnungshofes – der ausschließlich im doppisch buchenden Umfeld arbeitet – berichtete Dr. Ulrich Keilmann zur Entwicklung eines neuen Siedlungsindex, der das Problem der Kosten der Zersiedelung in den Blick nimmt. Vor allem machte er auf neue methodische Möglichkeiten durch Geodatenanalysen aufmerksam, die seit Neuestem komfortabel verfügbar seien. Zum Abschluss referierte Dr. habil. Christian Pfeil zu den grundlegenden Dilemmata, in denen der Stabilitätsrat seine Überwachung der Schuldenbremsen ab 2020 etablieren muss. Zwar lobte er den Stabilitätsrat hinsichtlich Wirkung und Bedeutung, versagte sich aber jeden Hinweis auf mögliche Auswege aus den Aporien, die der Gesetzgeber mit der leichter Hand aufgetürmt hat. Die nachfolgende Diskussion zeigte mehr Betroffenheit als Freude am Widerspruch.
Das übliche Projektgespräch am Schluss der Tagung nutzte Mitherausgeber Dr. Matthias Woisin für einen Einblick in die Überlegungen zur Weitentwicklung des Jahrbuchs und für Hinweise auf die aktuelle Diskussion im Kreis der Länderberichtsautoren. Prof. Dr. Thomas Lenk verabschiedete die Teilnehmer und schloss die Tagung mit einem Dank an das Orga-Team des Lehrstuhls und die Hilfe der Leipziger Sparkasse.
Auch der 11. Workshop wurde unterstützt von der Bundesbank in Leipzig, die den Teilnehmern zudem einen festlichen Abend bereitete, den Präsident Dr. Hubert Temmeyer mit einigen aktuellen fachlichen Hinweisen eröffnete. Der Hoffnung einiger Teilnehmer auf baldige Erhöhung des Leitzinses konnte er keine Nahrung geben.
Verlag
Das Jahrbuch für öffentliche Finanzen erscheint als Zeitschrift zweimal jährlich im Berliner Wissenschaftsverlag. Es wird betreut vom Lehrstuhl Finanzwissenschaft der Uni Leipzig.
Kontakt: redaktion[at]joefin.de
Das Jahrbuch für öffentliche Finanzen erscheint als Zeitschrift zweimal jährlich im Berliner Wissenschaftsverlag. Es wird betreut vom Lehrstuhl Finanzwissenschaft der Uni Leipzig.
Kontakt: redaktion[at]joefin.de
Projekt
Das Jahrbuch ist ein interdisziplinäres Projekt aus Rechts-, Finanz- und Politikwissenschaft sowie der Verwaltungspraxis. Das Projekt ist unabhängig, ehrenamtlich und wird gefördert von der Bundesbank.
Das Jahrbuch ist ein interdisziplinäres Projekt aus Rechts-, Finanz- und Politikwissenschaft sowie der Verwaltungspraxis. Das Projekt ist unabhängig, ehrenamtlich und wird gefördert von der Bundesbank.
Interesse
Im Vordergrund stehen die Landes- und Gemeindehaushalte sowie die föderalen Finanzbeziehungen.
Im Vordergrund stehen die Landes- und Gemeindehaushalte sowie die föderalen Finanzbeziehungen.